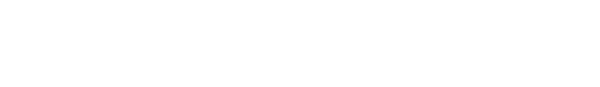Laufende Projekte
Alternative Methoden für Zeckenaufzucht und Infektionsmodelle
Zecken ernähren sich während ihres Lebens ausschließlich von Blut. Während sie sich von einem Tier ernähren, können Zecken mit einem von Zecken übertragenen Krankheitserreger infiziert werden, der bei Mensch und Tier Krankheiten verursachen kann. Um die Übertragungszyklen von Krankheitserregern zwischen Zecken und Wirbeltieren zu untersuchen, setzen die Forscher vor allem Labortiere ein. Die Tiere werden verwendet, um die Zecken zu füttern oder die Infektionsdynamik zu untersuchen, indem sie entweder die Zecken infizieren oder durch Zecken, die sich von ihnen ernähren, infiziert werden. Unser Projekt „Alternative Methoden für Zeckenaufzucht und Infektionsmodelle“ konzentriert sich auf die Optimierung eines künstlichen Fütterungssystems auf der Grundlage von Silikonmembranen. Dieses System wird seit Jahren verwendet, konnte aber aufgrund des uneinheitlichen Fütterungserfolgs bei Zecken die Labortiere nicht ersetzen. Außerdem ist das Fütterungssystem auf Tierblut angewiesen. Wir stellen jedoch die Hypothese auf, dass wir durch die Schaffung eines nährstoffreichen Alternativmediums den Bedarf an Blut und Labortieren verringern können. Außerdem könnte dieses standardisierte Substrat leicht von anderen Forschern für ihre Zwecke übernommen werden. Schließlich wollen wir dieses System nutzen, um Zecken künstlich zu infizieren, was kontrollierte Studien zur weiteren Erforschung der Prävention von durch Zecken übertragenen Krankheiten ermöglicht.
Beurteilung eines künstlichen Futtersystems für Zecken als Versuch der Ausklärung der Borrelia-Zecken-Interaktionen
Zecken, im Speziellen die Spezies Ixodes ricinus, übertragen eine Vielzahl an Pathogenen, inklusive Borrelia burgdorferi s.l., die Lyme-Borreliose verursacht. Die genauen Interaktionsmechanismen zwischen Zecken und Borrelia burgdorferi s.l. sind derzeit noch unbekannt. Um diese besser zu verstehen wurde ein Porjekt entwickelt, das sich einem künstlichen Futtersystem für Zecken bedient um den Einsatz von Labortieren zu vermeiden. Das Projekt an sich ist eine Kooperation mit Dr. Vanda Klöcklerová vom Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences in Bratislava, Slovakia.
Finanziert wird dieses Projekt durch SAIA, Aktion Österreich – Slowakei
Laufzeit: 03/2024 til 02/2025.
Verbesserte Überwachung von zoonotischen Fledermaus-assoziierten Pathogenen in Zentraleuropa
Das Projekt ist ein Joint Venture des Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences in Bratislava, Slovakia, der University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Slovakia und der Medizinischen Universität Wien, Österreich. Sein Ziel ist das Studium der Rolle von Fledermäusen in der Präsenz, Prävalenz und Verteilung von zoonotischen Pathogenen in Zentraleuropa. Das Projekt wird essentielle Erstinformationen liefern, die uns helfen werden die Rolle der Fledermäuse zu verstehen, Strategien zu entwickeln um die Ausbreitung zoonotischer Erreger zu verhindern und wichtige Informationen zu sammeln wie Fledermäuse geschützt werden können.
Finanziert wird dieses Projekt durch SAIA, Aktion Österreich – Slowakei
Laufzeit: 03/2024 bis 02/2025
Immunreaktion gegen Fleisch-Allergenen
Das Alpha-gal-Syndrome ist eine Art von Allergie, die durch Oligosaccharide (Galactose-α-1,3-Gelactose) ausgelöst wird, die in den Geweben der meisten Säugetiere (außer Menschen, Altwelt-Affen und Menschenaffen) vorkommt. Der Verzehr von alpha-gal-haltigem Fleisch kann eine verzögerte Reaktion hervorrufen, die bis zu einem anaphylaktischen Schock führen kann.
Neuste Studien konnten zeigen, dass bestimmte Zeckenarten (Ixodes ricinus und Amblyomma americanum) alpha-gal durch ihren Speichel übertragen können.
Gegenwärtig forschen wir daran welche Rolle Zecken in der Entwicklung dieser Allergie spielen.
Finanziert wird dieses Projekt durch den Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in Österreich (FWF) als Einzelprojekt.
PI Prof. Dr. Ines Swoboda, Fachhochschule Campus Wien, Fachbereich Molekulare Biotechnologie und Co-PI Ing. Michiel Wijnveld, PhD.
Laufzeit: 05/2021 bis 05/2026